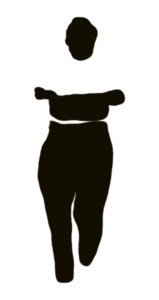…(Forsetzung Home]
Meine Großmutter war für ihre Zeit eine ungewöhnliche Frau. Sie war sehr klug, sehr groß und sehr schön. Jede Eigenschaft für sich allein genommen schon eine bloße Provokation, in jenem Land und in jener Zeit.
Sie war eine gütige und sehr sanftmütige Frau, die immer unter der Beobachtung ihrer Außenwelt stand. Aus dieser Position heraus war sie stets bemüht es immer besonders richtig zu machen. Es immer allen recht zu machen.
Trotz ihres jungen Alters erlangte sie so rasch das
Vertrauen der Menschen um sie herum. Sie wurde zu ihrer Vertrauensperson, wenn es um die kleinen und auch um die großen Krankheiten ging. Die des Körpers und die der Seele. Heute hat man für jedes Leiden einen eigenen Arzt. Einen für die Ohren, einen für die Knochen, einen für das Herz und einen für die Angelegenheiten des Herzens. Diese große und kluge Frau lernte durch stilles Beobachten, wie sie mehr tun konnte als Linderung zu schaffen. Immer unter argwöhnischer Beobachtung der Menschen um sie herum. Vieles schaute sie sich also heimlich ab, wenn sie den Ärzten bei der Arbeit über die Schulter blickte. Vieles las sie sich an, aus Büchern die nicht für sie bestimmt waren.
Doch dann kam der Krieg und die meisten Ärzte verließen das Dorf, die Stadt und irgendwann auch das Land. Sie flickten notdürftig Menschen zusammen, damit sie kurz darauf wieder notdürftig zusammengeflickt werden konnten. Vielleicht die schönste Zeit für meine Großmutter, eine Zeit in der sie nicht mehr beobachtet wurde. Eine Zeit, in der man dankbar ihre Hilfe annahm und nicht mehr fragte, warum sie so viel wollen würde und können würde, immer etwas unangemessenes dahinter vermutend.
Doch auch diese Zeit ging zu Ende. Plötzlich war das ihr bekannte Land ein anderes. Die Besitzansprüche änderten sich und da wo vorher ein Dorf stand, gab es nur noch eine Ansammlung von Straßen. Es gab nunmehr eine Straße mit Deutschen und schon der Nachbar wohnte in der mit Polen. Meine Großmutter war jetzt eine solche Deutsche und als diese musste sie ihrem neuen Herren dienen. Sie wurde als Krankenschwestern nach Köln gerufen, wo ihre Dienste benötigt wurden.
* * *
Als unverheiratete Frau hatte sie bis zu diesem Tag noch nie das Haus ihrer Eltern verlassen, geschweige denn etwas außerhalb ihres Dorfes gesehen. Die Anziehung von Köln muss wohl groß gewesen sein. Man kann es nur erahnen.
Und dann gab es diesen Mann. Es gibt ja immer irgendwie diesen Mann. Er war Soldat, wie alle Männer damals. Sie schenkte ihm ihre Zeit und ihr
Herz. Beide träumten von „danach“, dem Leben „danach“. Sie gingen gemeinsam tanzen und spazieren. Sie schmiedeten Pläne von einer kleinen Hochzeit, mit echtem Kaffee und einer großen Torte, von Kindern, von Festen als Familie unter einem Tannenbaum.
Doch dieses christliche Feste war das, was sie letztendlich trennte.
Ihm zuliebe ging sie mit ihm in „seine“ Messe, in eine evangelische Messe. Lange hatte sie mit dem Moment gehadert und es auch als Liebesbeweis für ihn getan. Für ihn, der dem falschen Glauben angehörte und doch so richtig war für sie. Wie konnte jemand nur so richtig und doch so falsch sein?
Die Messe hat meine Großmutter nie beendet, sie lief mittendrin unter den Augen aller aus dem Gotteshaus. Sie lief und lief und lief.
* * *
Das Laufen ist uns geblieben, es hat sich weitervererbt, wie bei anderen die Farbe der Augen oder das Grübchen am Mund. Die Frauen unserer
Familie sie gehen, sie stellen sich nicht dem Schmerz, sie laufen weg, bis die Füße so sehr brennen, dass das Herz nur noch ein dumpfes Pochen ist. Ich trage das auch in mir. Die Angst ist mein Motor.
Meine Großmutter kehrte nie wieder zurück zu dem Gottesdienst, zu dem Mann, zu der Stadt. Stattdessen kehrte sie in ihr kleines katholisches Dorf zurück, wo es nun keine Männer mehr gab. Sie waren alle entweder gestorben, in Kriegsgefangenschaft gekommen oder nur noch als leere Hülle zurückgekehrt.
Da war also diese große, kluge und schöne Frau, die wusste, dass sie keinen Mann mehr finden würde, der so war wie er. Der so war wie sie. Allein bleiben konnte sie nicht, wenn sie nicht ihren Lebtag unter Beobachtung stehen wollte. Verheiratete Frauen verschwinden, sie werden unsichtbar, wenn sie nicht gesehen werden wollten. Sie träumte also von dieser Hochzeit mit dem echten Kaffee, einer großen Torte und der Familie unter einem Tannenbaum.
Voller Hoffnung und Hoffnungslosigkeit traf sie so auf meinen Großvater. Ein einfacher Mann. Ein kleiner Mann. Kein schöner Mann. Aber er nahm sie so wie sie war. Es gab die Hochzeit, den Kuchen den Kaffee, drei Kinder unter dem Tannenbaum und vor der Bescherung die Christmette. Die Wichtige. Er schenkte ihr viele Schuhe und sie ihm das Gefühl etwas Besonderes zu sein, mehr als nur der Schuster mit den Träumen, die nie das Dorf verlassen würden.
Er war kein Mann des Wortes oder der Worte zwischen den Worten. Wenn er am Tisch sprachlos saß und nicht aß, lernte sie daraus, dass sie vergessen hatte, einen Löffel oder eine Gabel oder ein Messer zu decken. Sie lernte ihre Wünsche nicht zu äußern, nichts mehr für sich zu wollen. Stattdessen erzählte sie ihren Kindern immer von dem wundersamen Deutschland, dem schönem Deutschland. Dem Deutschland mit den großen
Städten, den bunten Lichtern, dem Lachen in den Tanzcafés. Sie flüsterte ihnen Träume ins Ohr und weckte so die Sehnsucht nach diesem Land in ihnen.
Die Kinder verließen irgendwann das Dorf und gingen nach Norddeutschland, einer nach dem anderen gingen sie und nahmen ihre Familien mit. Die Sehnsucht nach dem gelobten Land zog sie, die Angst vor erneutem Krieg im eigenen Land drängte sie. Irgendwann waren alle Kinder dort angekommen; überrascht, dass sie dort doch keine Deutschen waren, obwohl es ihnen immer gesagt wurde. Überrascht, dass man in diesem reichen Land mit 2 weiteren
Familien in einem Übergangslager, sogar nur in einem Zimmer, leben sollte. Die Zeit verging und jeder erarbeitete sich eine eigene Zukunft, fand seinen Platz in diesem fremd bleibenden Land. Dem Land mit den Menschen, die gar nicht so freundlich lachten in diesen Tanzcafés, dem Land mit den Lichtern, die für die Einen heller leuchteten als für die Anderen. Sie arbeiteten hart und waren immer fleißig, für ihre Kinder, die es mal besser haben sollten. Immer etwas strebsamer und immer etwas deutscher als die Deutschen es jemals waren.
Das war die Zeit, als meine Eltern mir einen anderen Namen gaben. Wie eine Jacke, die man einfach so ersetzen sollte gegen ein Jackett, das besser zum Anlass passte. Aus der „Reinen“ wurde der der deutscheste aller deutschen Namen. Ich hatte ihn mir selbst gewählt, ich kannte nur diesen. Schnell passten weder das Jackett noch die Jacke mehr und das Gefühl ist geblieben.
Meine Großeltern zögerten nach Deutschland zu kommen. Er konnte sich nicht vorstellen, sein Geschäft, sein Dorf und seinen Küchentisch mit dem fehlenden Löffel jemals zu verlassen. Sie fürchtete sich auch, fürchtete sich wohl vor den Wünschen, die sie nicht mehr hatte und der Nähe zu Köln. Irgendwann überwand sie ihre Furcht, aber ihr Dorf zog nur um. Bremen wurde ihr neues Dorf, das dass sie es nicht mehr verlassen wollte und dies bis zu ihrem Tod auch nicht tat.
Sie muss wohl geahnt haben, dass sie bald stirbt oder sie hatte es einfach so für sich beschlossen, möglich ist es bei dieser willensstarken Frau. Sie hatte einen Tumor an der Niere, die Operation war nicht gefährlich. Ein Routineeingriff, hieß es. Zeitgleich aber erkrankte mein Vater. Er war sehr jung und für ihn gab es nie eine Heilung, einzig ein Potpourri an Maßnahmen und Operationen, die sein kurzes Leid um einen Wimpernschlag verlängerten.
Es stand wieder eine Operation für ihn an und meine Großmutter verkündete daraufhin meiner Mutter, dass diese doch bitte jetzt nicht mehr zu ihr ins Krankenhaus kommen solle, dass diese sich nicht zwischen 2 Menschen zerreißen könne. Sie würde jetzt eh die Tage sterben. Das tat sie dann auch, einfach so, ohne sich etwas für sich zu wünschen.
Bevor sie starb, erzählte sie meiner Mutter von dem Mann aus Köln. Sie erzählte ihr von den Liebesbriefen, die sie bei sich zu Hause versteckte und die nie den Weg bis nach Köln fanden. Sie erzählte ihr von einem Leben voller ungeträumter Träume.
Kurze Zeit später starb auch mein Großvater, er kam mit dem Leben voller ungedeckter Löffel nicht zurecht. Auch er war ein starker Mann, dem leider nicht das Werkzeug gegeben wurde, diese Frau im Inneren zu berühren. Er liebte sie auf seine Art, nicht auf die ihre. Er setzte sich wenige Wochen nach Ihrem Tod abends auf das Sofa und so wurde er am nächsten Tag auch gefunden. Sein Tod war wie sein Leben, ohne Dramaturgie, ganz einfach und schmerzlos.
Irgendwann wurde die Wohnung ausgeräumt und meine Mutter suchte diese Briefe voller Liebe und Poesie und sie fand sie alle, nachdem sie zuerst Geld hinter alten Fotos fand, für schlimme Zeiten dort versteckt. Jeden einzelnen Brief fand sie. Eingeklebt in alte Kochbücher, in die nie jemand reinguckte außer ihr, die immer auf gedeckte Löffel achten musste. Meine Mutter machte es sich zur Aufgabe, diesen Mann zu finden, was ihr leider nicht gelang. Er war kurz nach meiner Großmutter oder kurz davor gestorben. Davor oder danach ist nicht wichtig, aber kurz. Stattdessen fand sie seine Töchter, denen er immer von meiner Großmutter erzählte. Von der großen, schönen, klugen Frau. Von der, die aus der Messe rannte und nie wieder zurückkehrte. Auch er hatte geheiratet und jemanden gefunden, mit dem er unter dem er unter der Tanne das christliche Fest feiern konnte. Sie starb sehr früh, hinterließ ihm aber ein Leben voller Zuneigung und Glück mit seinen Töchtern. Wie sie hatte auch er Liebesbriefe geschrieben und nie abgeschickt. Wohin hätte er sie auch schicken sollen. Da waren sie also, die Töchter zweier Liebenden mit Händen voller Liebesbriefe. Sie reichten sie von Bremen nach Köln und umgekehrt, so wie es ihnen immer bestimmt war.